
Autorin Meral Kureyshi: "Mich interessieren Dreiecks-Konstellationen"
Die mehrfach ausgezeichnete Schweizer Autorin Meral Kureyshi erzählt in ihrem dritten Roman "Im Meer waren wir nie" von drei Generationen einer Familie, die sich auf unterschiedliche Weise umeinander kümmern. Wir haben mit ihr gesprochen.
- Von: Darja Keller
- Bild: Matthias Günter
annabelle: In "Im Meer waren wir nie" geht es um transgenerationale Freundschaften, Altersheime, gegenseitige Fürsorge. Aus all diesen Themen ist eine stille, poetische Erzählung entstanden, in der trotzdem viel passiert. Was stand am Anfang des Schreibprozesses?
Meral Kureyshi: Ich beginne nicht mit einer konkreten Idee, sondern gehe einem Gefühl nach, das mich nicht in Ruhe lässt, das beisst, kratzt, irgendwie wehtut. In diesem Fall haben mich der Ort Altersheim und das Altwerden generell beschäftigt. In den letzten fünf Jahren habe ich viel Zeit im Altersheim verbracht.
Was haben Sie dort gemacht?
Ich sass in der Cafeteria und sprach mit den Bewohner:innen, vor allem mit älteren Frauen. Es war ein Gespräch, das nicht mehr aufhörte, und auch dann weiterging, wenn ich zwischendurch weg war und wiederkam. Ich habe gemerkt: Dieses Bedürfnis, zu sprechen, Erinnerungen zu teilen, ist da. Diese Frauen haben teilweise unglaubliche Sachen erlebt. Manchmal dachte ich: Wenn ich das aufschreibe, das glaubt mir niemand.
Zum Beispiel?
Eine Frau erzählte mir, dass ihr vor der Hochzeit alle Zähne gezogen wurden und sie als Mitgift ein künstliches Gebiss erhalten habe. Das hat man Anfang des 20. Jahrhunderts in der Schweiz tatsächlich noch gemacht, damit der Mann später nicht die Kosten für deine ausfallenden Zähne tragen musste. Jedenfalls: Aus diesen Gesprächen hätte man vier Bücher machen können. Die meisten Frauen wurden sehr selten besucht – und kamen dementsprechend wenig zum Erzählen –, obwohl ihre Kinder, Grosskinder, Urgrosskinder in derselben Stadt lebten.
Warum, glauben Sie, ist das so?
Ich denke, das hat mit der Generation zu tun: Die meisten von ihnen sind mit einer bestimmten Erziehungsform aufgewachsen und haben ihre Kinder auch so erzogen. Dieses 50er-Jahre-Ding – sparen mit dem Wort "Liebe", ein höflicher, aber distanzierter Umgang. Ich denke, diese Erziehungsform führte dazu, dass die Distanz zu ihren eigenen Kindern im Laufe des Lebens immer grösser wurde. Man hält vieles zurück, auch den eigenen Schmerz: Diese Frauen haben sich nie über den mangelnden Besuch beklagt, sie haben ihre Verwandten entschuldigt, gesagt, die sind beschäftigt, die kommen dann schon. Das fand ich schlimm. Dass sie nicht mal gesagt haben: Was soll das, ich habe mein Leben geopfert, ich war die ganze Zeit da und habe alles getan, was ich konnte, und jetzt bin ich allein.
"Auch in meine Freund:innen muss ich mich verlieben, sonst interessieren sie mich nicht. Es braucht eine Grundspannung"
Die Protagonistin Ihres neuen Buchs übernimmt dann genau diese Betreuungs- und Zuhör-Arbeit: Sie besucht die 90-jährige Lili, die Grossmutter ihrer besten Freundin, regelmässig im Altersheim.
Genau. Sie wird dafür von Lilis Tochter bezahlt, es gibt einen Vertrag und alles. So nähern sich Lili und die Ich-Erzählerin an, und es entsteht eine Freundschaft. Mich hat interessiert: Wie funktionieren die unterschiedlichen Freundschaften in der Geschichte? Wie öffnen und distanzieren wir uns?
Diese Freundschaft zwischen der Ich-Erzählerin und ihrer besten Freundin Sophie wird so detailliert und schmerzhaft geschildert, wie man es sonst oft über Liebesbeziehungen liest. Einmal sagt Sophie zur Ich-Erzählerin: "Wir funktionieren nur noch, wie ein altes Ehepaar, das keinen Sex mehr hat."
Es ist ja auch eine Liebesbeziehung. Auch in meine Freund:innen muss ich mich verlieben, sonst interessieren sie mich nicht. Es braucht eine Grundspannung. Natürlich gibt es einen Unterschied zu romantischer Liebe, aber auch viele Ähnlichkeiten. Zum Beispiel: Die Ich-Erzählerin und Lili verlieben sich auch ineinander. Das bedeutet erst mal: Es passiert irgendetwas. Und das, was passiert, ist gleichzeitig mein Antrieb zum Schreiben. Ich muss mich auch in die Figuren verlieben, um weiterzuschreiben, sie kennenlernen zu wollen, zu sehen, was als Nächstes passiert.
"Ich wollte Beziehungen zeigen, die sich nicht linear entwickeln"
Bei Sophie und der Ich-Erzählerin fragt man sich beim Lesen: Wie kommt eine Freundschaft aus dem Stillstand wieder in die Bewegung?
Ich wollte Beziehungen zeigen, die sich nicht linear entwickeln, sondern eine gewisse Elastizität haben. Manchmal sind sie angespannt, manchmal fast im Stillstand, aber irgendwas bewegt sich fast immer in irgendeine Richtung. Dieses Gefühl habe ich als Ausgangspunkt genommen. Mich haben Dreiecks-Konstellationen interessiert, schon in früheren Büchern. Eine Beziehung zwischen zwei Personen, dann kommt eine dritte hinzu. Das kann alles sein: eine Schwester, ein Kind, eine Partnerin. Durch die dritte Person kommt die Konstellation der zwei Personen in Bewegung und verändert sich.
"Im Meer waren wir nie" ist ein langsames Buch: Obwohl die Protagonistin mit der Betreuung eines Kindes und der alten Lili viel zu tun hat, scheint sie sich der Kultur des ständigen Beschäftigt-Seins zu entziehen: Sie macht Umwege, setzt sich ins Café und plaudert mit dem Kellner, liegt im Bett herum.
Ja, das war mir wichtig. "Im Meer waren wir nie" ist ein Buch der Umwege. Die Ich-Erzählerin hat etwas Trotziges, sie will nicht mitmachen und einfach funktionieren wie alle anderen. Das ist mit ein Grund, warum sie die Besuche bei Lili übernimmt, obwohl ihr Umfeld sagt: "Warum machst du nicht etwas anderes? Du bist doch überqualifiziert für diese Aufgabe."
Wenn man Ihre Bücher liest, fällt auf: Bestimmte Motive, Wörter, ganze Sätze wiederholen sich. Arbeiten Sie an einem grossen Gesamtwerk?
(lacht.) Nein, ich spiele einfach gerne. Ich betrachte meine Bücher nicht getrennt voneinander. Die Protagonistin ist immer dieselbe. Ich bin beeindruckt, wie oft ich auf die Wiederholungen angesprochen werde. Das bestätigt mich darin, dass ich den richtigen Satz für die Wiederholung gewählt habe. Ich suche nach Sätzen, die bleiben. Die Wiederholungen bilden eine Art Refrain.
Ein bisschen wie Musik?
Ja, oder sogar wie ein Gebet oder ein Mantra. Oder wie ein Märchen. Ich glaube, ich schreibe eigentlich Märchen. Mein erstes Buch, "Elefanten im Garten", beende ich mit dem Satz "Es war einmal, es war keinmal". Das ist der erste Satz jedes türkischen und arabischen Märchens, man sagt am Anfang: Es könnte so gewesen sein, aber auch anders. Als ich mit zwölf das erste Mal deutsche Märchen gelesen habe, die ja nur mit "Es war einmal" beginnen, war ich schockiert und fragte meine Mutter: Heisst das, es ist tatsächlich so passiert?
Wie schreiben Sie?
Sehr viel und sehr langsam. Ich brauche Zeit. Ich habe das grosse Privileg, als freie Autorin leben zu können. Alle fünf Jahre kommt ein Buch. Ich könnte auch alle zwei Jahre eins schreiben, aber das Buch wäre dann halt scheisse. Ich mag Texte, die dicht sind, ich mag es, jeden Satz wirklich auseinanderzunehmen und die Sätze rhythmisch aneinanderzureihen. So arbeite ich jeweils etwa zwei, drei Jahre am Text, und dann lasse ich ihn ein Jahr liegen. Wenn ich den Text wieder lese nach dieser Zeit, schreibe ich nochmal alles um, es kann sich noch einmal alles verändern.
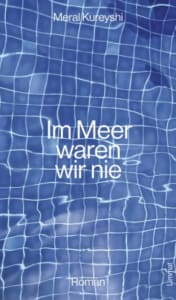
Meral Kureyshi, geboren 1983 in Prizren, kam 1992 mit ihrer Familie in die Schweiz. Ihr Debütroman "Elefanten im Garten" stand 2015 auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises. Ihr Roman "Fünf Jahreszeiten" wurde 2020 mit dem Literaturpreis "Das zweite Buch" der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung ausgezeichnet. Meral Kureyshi lebt als freie Autorin in Bern, unterrichtet an der Zürcher Hochschule der Künste und arbeitet als Leiterin von Textwerkstätten. Ihr dritter Roman "Im Meer waren wir nie" erscheint am 20. Februar im Limmat Verlag. Vernissage in Zürich am 24.2.2025, 20.00 Uhr im Kaufleuten (Moderation: Nina Kunz); Buchpräsentation in Bern am 13.3.2025, 19.30 Uhr im Zentrum für Kulturproduktion PROGR (Moderation: Barbara Loop).







