
Deutsch-iranische Autorin Gilda Sahebi: "Gegen eine verbundene Gesellschaft ist jegliche autoritäre Macht chancenlos"
Hauptsache polarisieren: Die Gesellschaft scheint je länger, je mehr auseinanderzudriften. In ihrem neuen Buch "Verbinden statt spalten" geht die deutsch-iranische Autorin Gilda Sahebi diesem Phänomen nach.
- Von: Helene Aecherli
- Bild: Hannes Leitlein
annabelle: Gilda Sahebi, «wir» gegen «die», «die Woken», «die Faulen», «die Migranten», «die Linken», «die Rechten»: Politische und mediale Debatten drehen sich zunehmend um Pole. Was geschieht da gerade?
Gilda Sahebi: Diese «Gut-Böse»-Erzählung greift zunehmend um sich, wirkt immer mächtiger. Und dies nicht, weil eine Mehrheit der Menschen ihr zustimmen würden, sondern weil Politiker:innen im gesamten demokratischen Spektrum und auch Medien diese Erzählung zunehmend mitbefeuern und sie damit legitimieren.
Sie sagen, dass Sie selbst einen grossen Teil Ihres Erwachsenenlebens davon überzeugt gewesen waren, dass sich Menschen und alle politischen Aussagen in links und rechts einteilen lassen. Hat Sie das dazu bewogen, diese klare Ordnung in Ihrem neuen Buch in Frage zu stellen und ihr auf den Grund zu gehen?
Ja, es war im Prinzip die Arbeit an mir selbst. Seit meinem Politikstudium habe ich mich als politisch links betrachtet und war auch lange davon überzeugt, dass dies die einzig richtige Einstellung ist, die man auf dieser Welt haben sollte. Doch vor ein paar Jahren habe ich begonnen, diese Haltung zu hinterfragen: Warum glaube ich, dass meine politische Ansicht die richtige ist? Warum verurteile ich andere Menschen? Erfahre ich die Welt nur über das Narrativ, das ich kenne? Wie reagieren Menschen in meinem Umfeld auf mich, wenn ich alle in Gut und Böse einteile? Also fing ich an, an mir zu arbeiten.
Wie haben Sie das getan?
Ich habe versucht, Neugier zu entwickeln und zu überlegen, ob das, was ich glaube, vielleicht auch anders sein könnte. Zudem sage ich mir immer: ein Auge nach aussen, ein Auge nach innen, um zu sehen, wie ich mich in dieser polarisierten Welt bewege.
Dabei sind sie nicht nur sich selbst, sondern auch einem gesellschaftlichen Phänomen auf die Spur gekommen.
Sozusagen ja, weil sich meine Augen für andere Meinungen geöffnet haben. Wenn man immer überzeugt ist, recht zu haben, und anderen deshalb nicht zuhört, entgeht einem vieles. In der Folge habe ich auch erkannt, wie polarisierend die politischen Debatten heute geführt werden, auch in den Medien, und mir gesagt: Es kann doch nicht sein, dass wir so gegeneinander sind. Sehen Sie, ich reise oft durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dabei begegne ich unglaublich vielen Menschen, die Gutes für andere wollen, die sich Gedanken machen und sich engagieren. Klar wählen manche wohl eine Partei, die ich nicht wählen würde, oder haben Ansichten, die ich nicht teile – trotzdem verstehen wir uns oft sehr gut. Dieses Miteinander und diese gegenseitige Verbundenheit machen ja gerade die demokratische Realität in unserer Gesellschaft aus.
"Gruppenverhalten wird dadurch bestimmt, dass Unterschiede zwischen Menschen gemacht werden"
Diese Verbundenheit scheint jedoch verloren zu gehen. Welche Mechanismen liegen dieser Spaltung, oder zumindest dem Gefühl der Spaltung zugrunde?
Die Mechanismen ist in erster Linie dadurch zu erklären, dass wir Menschen zu Gruppenverhalten neigen. Man sieht sich zum Beispiel als Teil einer Familie, einer Nachbarschaft, einer Stadt, einer Glaubensgemeinschaft oder einer Gruppe mit einer bestimmten sexuellen Orientierung. Das ist etwas sehr Positives und entwickelt sich bei jedem Menschen individuell. Gleichzeitig weiss man aus der Forschung, dass das Merkmal, das zu einer Gruppenbildung beiträgt, komplett willkürlich sein kann. So zeigen etwa Studien, dass Gruppengefühle schon dann entstehen können, wenn die Mitglieder der einen Gruppe ein grünes, die anderen ein rotes Armband erhalten. Folglich wird das Gruppenverhalten nicht durch die Art der Unterschiede bestimmt, sondern dadurch, dass Unterschiede zwischen Menschen gemacht werden.
Was aber nicht zwingend problematisch sein muss.
Nein, zum Problem wird es aber dann, wenn diese menschliche Neigung zum Gruppenverhalten instrumentalisiert wird. Das zeigte sich etwa an der Diskussion um die Impfpflicht während der Corona-Pandemie. Da sagte das Lager der Befürwortenden: «Die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, sind schuld daran, wenn wir alle noch kränker werden und die Hälfte der Menschen in unserer Gesellschaft stirbt.» Das Lager der Impfgegner:innen – in Deutschland angeführt von der AfD, in den USA von der Maga-Bewegung – hingegen liess verlauten: «Die Anderen wollen euch zwingen, euch zu impfen. Ihr werdet unfrei. Die sind euere Feinde.» Obwohl gemäss Studien in Deutschland nur etwa fünf Prozent der Menschen wirklich festgefahrene Impfgegner:innen oder Impfbefürworter:innen waren – die meisten befanden sich irgendwo dazwischen – ist es der AfD damit gelungen, an Popularität zu gewinnen.
Inwiefern ist das Internet für diese Verzerrung mitverantwortlich?
Es ist eine Katastrophe. Ich muss nur einmal auf die Plattform X gehen, um den Eindruck zu gewinnen, dass sich alle hassen. Posts etwa des Tech-Milliardärs Elon Musk aus dem Jahr 2024, die falsche Informationen und Aussagen enthielten, wurden zwei Milliarden Mal gesehen – also in einer entscheidenden Zeit, während des letzten US-Präsidentschaftswahlkampfs. Natürlich bekommt man dann den Eindruck, die Rechten oder die Linken seien absolut bösartig. Und vor allem auch die Wähler:innen dieser beiden Seiten. Besonders extrem geworden ist es auf X seit dem 7. Oktober 2023. Man glaubt wirklich, es gäbe nur zwei Seiten, und alle seien entweder radikale pro-Palästina- oder pro-Israel-Aktivist:innen. Wenn ich jedoch mit Menschen in meiner Umgebung spreche, stelle ich fest, dass ein sehr differenzierter Blick auf den Konflikt vorherrscht.
"Jüngere Menschen sind häufig empfänglicher für autoritäre Kräfte als es die Generation ihrer Eltern war"
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Macht, vor allem autoritäre Macht, Spaltung braucht, um sich entfalten zu können. Heisst das, dass autoritäre Kräfte gesellschaftliche Dynamiken besonders clever für sich nutzen, gar einen Masterplan haben?
Viele autoritäre Kräften folgen wirklich einem Plan. Es geht darum, Menschen auseinanderzubringen, damit sie nicht mehr erkennen, dass sie Teil einer Gesellschaft sind und die Grundlage für einen demokratischen Staat bilden. Vor ein paar Wochen wurde ein Strategiepapier der AfD veröffentlicht, in dem die Partei von Spaltung spricht, von Polarisierung und Kulturkampf. Die schauen sich diese Strategie von US-Präsident Donald Trump ab, sehen, dass sie das genauso machen müssen, um zu gewinnen. Und sie haben recht.
Das hört sich nun aber fast schon wie eine Verschwörungstheorie an. Damit Spaltung überhaupt gelingen kann, müssen doch bei grossen Teilen einer Bevölkerung schon Gefühle der Benachteiligung vorhanden sein. Etwa, die Angst, finanziell nicht mehr auf einen grünen Zweig zu kommen, keine Wohnung oder Arbeit mehr zu finden. Und: Sie müssen das Gefühl haben, mit dieser Angst alleingelassen zu werden, gerade von Linksparteien, während die rechten ihnen Gehör verschaffen.
Genau, das ist sehr wichtig. Die ökonomischen Sorgen sind real, und sehr viele Menschen fühlen sich mit ihren Ängsten und Sorgen nicht ernst genommen. Die Gewissheit ist verschwunden, dass man sich ein gutes Leben leisten kann, wenn man nur hart genug arbeitet. Aus diesem Grund ist in vielen Gesellschaften der Antrieb nicht mehr vorhanden, alles dafür zu tun, dass es der nächsten Generation besser geht. Diese Stimmung ist ein Steilpass für autoritäre Kräfte, die diese geschickt für sich zu nutzen wissen. So ist auch zu erklären, weshalb Menschen, die sozial abgestiegen sind, signifikant häufiger eine autoritäre Partei wählen. Zudem sind jüngere Menschen häufig empfänglicher für autoritäre Kräfte als es die Generation ihrer Eltern war. Und das ist für eine demokratische Gesellschaft gefährlich.
In polarisierten Gesellschaft sind sogenannte Opfererzählungen besonders wirksam. So sehen sich etwa islamistische Herrscher als Opfer des Westens, der russische Präsident Vladimir Putin ebenso, und US-Präsident Donald Trump inszeniert sich gerne als Opfer der Demokraten und der Medien. Warum funktioniert diese Opfererzählung so gut?
Weil sie auch bei uns persönlich so stark wirkt. Fühle ich mich ungerecht behandelt, bin ich überzeugt davon, dass mir jemand etwas Böses will und ich angegriffen werde. Dieser Impuls lässt sich kaum kontrollieren, insbesondere, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Donald Trump sagt es sogar klar und deutlich: «I'm your revenge», ich bin quasi wie ihr, ich räche mich für euch! Und wenn sich Menschen benachteiligt fühlen, wenn sie merken, dass sie ihren Kindern nicht mehr das bieten können, was sie gerne möchten, fallen solche Erzählungen auf fruchtbaren Boden. Man kann das, wie gesagt, bei islamistischen Herrschern beobachten, bei Putin, Trump oder bei der AfD. Sie schaffen es, ihren Anhänger:innen das Gefühl zu geben: Wir verstehen euch und kämpfen für euch. Was eine komplette Lüge ist, aber sie funktioniert. Sie ist der Treibstoff für den autoritären Umbau.
"Wenn man glaubt, man stünde auf der richtigen Seite, wird man in der Regel nur für diese Empathie haben"
Besonders interessant ist, was Sie in Ihrem Buch über das Zusammenspiel von Empathie und Hass schreiben. Können Sie das erläutern?
Das kann man gerade an dem hoch-polarisierenden Thema Israel-Gaza sehen: Wenn man glaubt, man stünde auf der richtigen Seite, wird man in der Regel nur für diese Empathie haben. Daraus entwickelt sich häufig unfassbare Empathielosigkeit für die andere Seite.
Das bedeutet, dass einseitig empfundene Empathie in eine Art Radikalisierung münden kann?
Genau. Es handelt sich um eine emotionale Radikalisierung. So erklärt etwa der Literatur-, Kultur- und KognitionswissenschaftlerFritz Breithaupt in seinem Buch «Die dunklen Seiten der Empathie», dass viele extremistische Terroristen höchst empathisch sind – für ihre Seite. Womit sie wiederum ihre absolute Grausamkeit gegenüber der anderen, gegnerischen, Seite rechtfertigen.
Heute heisst es oft, man müsse Empathie für «die andere Seite» und seine politischen Gegner:innen aufbringen. Sie plädieren hingegen für mehr Mitgefühl. Worin liegt für Sie der Unterschied?
Empathie bedeutet, die Gefühle der anderen Person zu spüren. Das möchte ich jedoch nicht, denn dabei verschwimmen die Grenzen zwischen mir und der anderen Person. Das hat auch etwas Verklebendes, wodurch dem Menschen, um den es geht, nicht unbedingt geholfen ist. Mitgefühl hingegen impliziert Augenhöhe: «Ich sehe und verstehe deinen Schmerz.» Deshalb rede ich lieber von Mitgefühl.
Immer wieder ist zu beobachten, wie ähnlich sich progressive und erzkonservative Aktivist:innen verhalten. Wie kommt das?
Was sie gemeinsam haben, ist die affektive Polarisierung, also diese absolute Überzeugung, dass sie im Recht sind, auf der moralisch guten Seite. Diese absolute vermeintliche moralische Überlegenheit findet man in den unterschiedlichsten Lagern. Zwar sind solche Aktivist:innen in der Minderheit, aber sie sind die Lautesten. Folglich berichten Mainstream-Medien eher über diese Polarisierer:innen. Die vielen Menschen, die irgendwo dazwischenstehen, hört und sieht man nicht. Sie kommen in der Öffentlichkeit kaum zu Wort.
"Es herrscht auf politischer Ebene viel zu wenig Bewusstsein dafür, was gerade passiert. Polarisierung wird kaum verstanden"
Sie nehmen auch die Medien in die Pflicht.
Natürlich, ihr Anteil an den Spaltungserzählungen ist riesig. Dabei würde die Verantwortung von Medien darin liegen, sich immer wieder mutig zu fragen: Sind wir machtkritisch genug? Nennen wir Lügen auch Lügen? Hinterfragen wir Politiker:innen genug oder wiederholen wir bloss deren polarisierende Narrative oder jene bestimmter Influencer, der «Medienpolarisierungsunternehmer»? Derzeit sehe ich nicht, dass dies ausreichend geschieht.
Was heisst das nun für politische Parteien? Wie gelingt es ihnen, vermehrt die vielen Menschen zwischen den Polen anzusprechen?
Links- und Mitteparteien müssten sich bewusst weigern, polarisierende Narrative zu übernehmen, und ehrlich ansprechen, wo sie in der Gesellschaft die Probleme sehen. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass sich Bedürfnisse von Menschen mit höherem Einkommen und Vermögen häufiger in der Politik widerspiegeln als jene von Menschen, die weniger haben. Das darf in einer Demokratie nicht sein. Das heisst, Vetreter:innen von politischen Parteien müssten einfach mehr mit Bürger:innen sprechen. Und zwar regelmässig, nicht nur vor Wahlen.
Sie zitieren in Ihrem Buch Daniel Ziblatt, den amerikanischen Politologen und Autor von «Wie Demokratien sterben». Er sagt, dass sich in jeder Gesellschaft bis zu dreissig Prozent der Bevölkerung dem autoritären Weg zugeneigt fühlten. Wie problematisch ist das?
Das ist an sich kein Problem. Gefährlich wird es aber, wenn demokratische Politiker:innen sich mit Autoritären verbünden, um Ämter und Macht zu erhalten. Dieses Szenario ist derzeit zwar noch nicht eingetreten, aber es herrscht auf politischer Ebene viel zu wenig Bewusstsein dafür, was gerade passiert. Polarisierung wird kaum verstanden.
"Wir werden nichts verändern können, wenn wir einander bekämpfen, sondern nur, wenn wir uns verbinden"
Wie pessimistisch sind Sie, wenn Sie in die Welt hinausblicken?
Nun, ich versuche, soweit es geht zu beobachten und zu beschreiben. Dass der autoritäre Umbau in vielen europäischen Staaten gerade vonstatten geht, ist faktisch so. Aber pessimistisch bin ich nicht. Was mir immer wieder Mut macht, sind die Menschen, und die Tatsache, dass der absolute Grossteil nicht in einem autoritären Staat leben will. Das sehen wir auch in den USA: Vor ein paar Wochen wurde eine interessante Umfrage zum Thema Immigration veröffentlicht. Darin gaben 79 Prozent der Befragten an, dass sie Migration – notabene die allerstärkste Spaltungserzählung überhaupt – fürs Land wichtig finden. Das sind richtig viele, und ich denke, das wird bei uns in Europa ähnlich sein. Sie sehen, mein Glaube an unsere Gesellschaft gross.
Vielleicht ist es an der Zeit, uns diesen Glauben ins kollektive Bewusstsein zurückzurufen.
Ja, genau. Das heisst nicht, dass man die diskriminierenden, rassistischen oder sexistischen Strukturen in der Gesellschaft ignoriert. Die sind alle da, die sind real. Es geht mir darum, zu betonen, dass die meisten Menschen andere eben nicht diskriminieren. Wird uns das als Gesellschaft klar, nehmen wir uns über unsere Grenzen und Gefühle die Macht zurück. Dann können wir uns mit den Problemen auseinandersetzen und brauchen nicht in der Polarisierung mitzumachen. Wir werden nichts verändern können, wenn wir einander bekämpfen, sondern nur, wenn wir uns verbinden.
Zugegebenermassen eine gigantische Aufgabe.
Natürlich. Ich muss nicht gleich das ganze Land verbinden. Aber wenn ich es zum Beispiel schaffe, zu Menschen in meiner Nachbarschaft Verbindungen herzustellen, beginnen vielleicht auch andere damit. Und irgendwann werden es immer mehr Menschen sein, die miteinander verbunden sind. Damit ist schon viel gemacht. Und gegen eine verbundene Gesellschaft ist jegliche autoritäre Macht chancenlos.
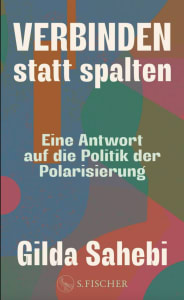
Gilda Sahebi: Verbinden statt spalten. Eine Antwort auf die Politik der Polarisierung. Verlag S. Fischer, Frankfurt a. M., 2025, 256 Seiten, ca. 35 Fr.
Gilda Sahebi spricht mit annabelle-Reportage-Leiterin Stephanie Hess über ihr neues Buch: Literaturfestival Buch Basel, 15. 11., 18.30 Uhr, Volkshaus Basel. Tickets gibt es hier.







