
Lea von Bidder über Start-ups: "Wenn du dich als Frau im Silicon Valley zu sehr exponierst, wirst du gnadenlos zerlegt"
Mit 26 gründete sie Ava und galt als Wunderkind der Schweizer Start-up-Szene. Dann folgte der Absturz. Heute erzählt sie, warum Panikattacken und Niederlagen ihr Leben veränderten.
- Von: Jacqueline Krause-Blouin
- Bilder: Jairo N’Tango
Mit Ava gründete Lea von Bidder eines der bekanntesten Femtech-Unternehmen der Welt, stand auf internationalen Bühnen und schaffte es auf die «Forbes 30 under 30»-Liste. Ava entwickelte erfolgreich ein Armband zum Fruchtbarkeits- und Zyklustracking. Doch neben tausenden «Ava-Babys» gab es auch geplatzte Finanzierungsrunden, einen riskanten Verkauf – und am Ende das Scheitern. Nun erscheint ein Buch über die Geschichte ihres Unternehmens und somit auch ihre persönliche. Heute spricht von Bidder offen über Scham, Schuldgefühle und den Mut, Niederlagen öffentlich zu machen.
annabelle: Als Sie zum ersten Mal gefragt wurden, ob Sie für das Buch «Die Kindermacher» Auskunft über Ihre Geschichte geben würden, haben Sie sofort abgelehnt. Warum?
Lea von Bidder: Die Zeit nach Ava war sehr schwer für mich, die Firma war mein ganzes Leben, meine Identität und gefühlt alles, was ich jemals geleistet hatte. Und als es vorbei war, war das ein Schock. Ich habe auch zwei Jahre lang mit niemandem darüber sprechen können, es war zu schmerzhaft. Und erst recht nicht öffentlich, ich wollte diese ganze Aufmerksamkeit nicht mehr.
Warum hat sich das jetzt verändert?
Es hat Zeit gebraucht. Am Anfang habe ich nur das Schlimme gesehen: den Verlust, den Identitätsbruch. Ava war mein Leben, mein Beruf und mein Image. Erst nach etwa zwei Jahren konnte ich erkennen, dass die Erfahrung Wert hat – für ehemalige Mitarbeitende, für das Schweizer Start-up-Ökosystem und für mich. Die Geschichte zu erzählen, hilft, sie einzuordnen – und vielleicht auch anderen jungen Gründer:innen, die gerade mittendrin im Chaos stecken.
Sie waren das Gesicht der Firma. Wie hat sich diese Sichtbarkeit angefühlt?
Als Teil des Jobs. Ich lebte damals in San Francisco, war weit weg von der Schweiz. Das half, die öffentliche Aufmerksamkeit zu abstrahieren. Klar, Sichtbarkeit erhöht den Druck – aber der Druck ist ja sowieso von allen Seiten her riesig.
"Ich habe mein Selbstbild komplett gleichgesetzt mit der Marke"
Noch heute wenden sich Kund:innen an Sie, wenn ein Armband streikt. Das zeigt, wie eng Ihre Person mit Ava verbunden war. Haben Sie diese Gleichsetzung auch für sich selbst gemacht?
Ja, sicher. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich in Meetings mit «Ava» statt «Lea» angesprochen wurde. (lacht) Ich war nun mal unter anderem für das Marketing verantwortlich, und das hat dazu geführt, dass ich eine Marke geschaffen habe, die 1:1 ich war. Ich habe mein Selbstbild komplett gleichgesetzt mit der Marke, was das Scheitern natürlich umso persönlicher macht. Als es endete, war es nicht nur ein beruflicher, sondern ein persönlicher Absturz.
Ava wurde schliesslich an einen amerikanischen Femtech-Konzern verkauft. Gab es für Sie schon vorher Momente, in denen Sie am liebsten aufgehört hätten?
Ja, so ungefähr hundert! (lacht) Die Belastung war einfach wahnsinnig. Ich habe mich oft gefragt, warum ich mir das eigentlich antue.
Was war der schmerzhafteste Moment?
Ich glaube, als ich gemerkt habe, dass unser Plan mit der Akquisition nicht aufgeht. Als das Unternehmen, das uns gekauft hat, plötzlich Rechnungen nicht mehr bezahlte und ich vom CEO geghostet wurde, obwohl mir eine wichtige Position versprochen worden war, wurde mir klar: Das wird nichts. Dann wurde ich gebeten, eine Kündigungsliste mit Namen meiner Mitarbeitenden zu erstellen. Ich setzte meinen eigenen Namen ganz oben auf die Liste.
Nach aussen hin muss man so tun, als sei alles in Ordnung, auch wenn es hinter den Kulissen brodelt. Sehen Sie das heute kritisch?
Als Start-up-CEO lebt man von Investor:innengeldern, da muss man leider öfter gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich glaube, es gibt noch keine Realität, in der man transparenter sein kann. Würde ich mir das wünschen? Ja, auf jeden Fall. Aber an diesem Punkt stehen wir noch nicht.
"Warum sollte man sich trauen, Grosses zu wagen, wenn sogar die Erfolgreichen kleingeredet werden?"
Im Buch wird erwähnt, dass Sie Meilensteine bei Ava oft nicht als Erfolg empfunden haben. Warum?
Ich habe bei Ava immer das Gefühl gehabt, dass wir hinterherhinken. Dass wir keine Zeit hatten, um Erfolge zu feiern, weil schon wieder das nächste Problem am Horizont auftauchte. Bei uns waren Meilensteine oft «Hygienefaktoren». Heute würde ich das wohl anders machen, weil niemals alle Probleme gelöst sein werden. Es ist besser für das Team und für einen selbst, wenn man zwischendurch einmal innehalten und mit Stolz auf das blicken kann, was man geschafft hat.
Sie wurden als «overconfident» bezeichnet. Stimmen Sie zu, dass Sie und Ihr Team teilweise zu Selbstüberschätzung neigten?
Nein, eigentlich nicht. Wir hatten eine wahnsinnig grosse Vision, wir wollten Frauen auf der ganzen Welt helfen, schwanger zu werden. Aber wir waren gar nicht immer confident, eigentlich haben wir die ganze Zeit gezittert, ob es klappen wird. Aber wir haben uns halt getraut. Leider muss ich sagen, dass wir dahingehend vor allem in der Schweiz kritisiert wurden, weil man hierzulande nun mal Freude daran hat, die Leute kleinzuhalten.
Sie sprechen oft von Schweizer Zurückhaltung. Wie bremst Sie uns?
Wir sanktionieren Risiko kulturell: Wer gross denkt, wird belächelt. Wer fällt, wird moralisch bewertet. Das kostet uns wertvolle Zukunftschancen. Denn die grossen Probleme – Klima, Gesundheit, Alterung – brauchen Menschen, die gross denken und aushalten, dass es unterwegs holprig wird.
On, die international erfolgreiche Schweizer Laufschuh- und Sportmarke, ist eine der grossen Schweizer Erfolgsgeschichten. Warum tun wir uns so schwer damit, solche Leistungen einfach zu feiern?
Das ist sehr schweizerisch: Statt vorbehaltlos zu sagen «Wow, genial!», suchen wir sofort nach dem Haken. Selbst bei On, einem unglaublichen Erfolg, hört man Kommentare wie: «Ja, aber … da war neulich ein Stein in meinem Schuh!» (lacht) Dieses Relativieren zieht sich durch unsere Kultur. Das Problem: Wenn sogar die Erfolgreichen kleingeredet werden, warum sollte sich jemand trauen, Grosses zu wagen? Wir müssen lernen, Leistungen offen zu feiern – auch wenn nicht alles perfekt war. Wir sind in Zeiten von Selbstoptimierung zu Perfektion erzogen und leben zu sehr nach der Devise: Wenn nicht perfekt, dann lieber gar nicht.
Rückblickend: Woran ist Ava wirklich gescheitert?
Es gibt fast nie den einen Grund. Start-ups bewegen sich immer nah an der Null – bis entweder eine neue Finanzierungsrunde kommt oder ein Verkauf. Vielleicht hätten wir mit einer weiteren Runde gewisse Probleme lösen können, vielleicht auch nicht. Am Ende ist Scheitern fast nie nur eine Sache, sondern eine Mischung aus Timing, Geld, Regulierung, Marktpassung – und schlicht auch Glück.
"Man kann nicht Millionen in unerfahrene 25-Jährige pumpen und sich wundern, wenn sie unter dem Druck wanken"
Sie machen jetzt öffentlich, dass Sie unter Panikattacken litten – ein Tabu, vor allem in Führungsrollen. Das erste Mal passierte es ausgerechnet beim Interview zum «30 under 30»-Artikel vom renommierten Magazin «Forbes». Was hat diese Erfahrung mit Ihnen gemacht?
Ich hatte immer das Gefühl, ein sehr leistungsfähiger Mensch zu sein. Das hat auch viel mit Feminismus zu tun, weil ich zeigen wollte, dass ich Dinge schaffen kann, die man jungen Frauen vielleicht bis anhin nicht zugetraut hatte. Ich wollte eine Vorreiterin sein. Ich hatte keine Ahnung, dass ich jemals an mein Limit kommen könnte, dass ich überhaupt ein Limit habe. Ich kannte damals das Wort Panikattacke nicht – ernsthaft. Ich landete im Spital und dachte, ich hätte einen Herzinfarkt. Das Lernen kam rückwärts: erst die Symptome, dann die Sprache dafür. Später las ich den Post eines Gründers über seine Panikattacke. Das hat mich unendlich erleichtert, weil es mein Erlebtes normalisiert hat. Genau deshalb habe ich das Thema im Buch gelassen – obwohl es der Teil war, den ich am liebsten gestrichen hätte, weil es natürlich schambehaftet ist.
Wie schätzen Sie die Lage im Silicon Valley heute ein? Ist es immer noch «cool» auszubrennen?
Ja, diese Hustle-Kultur gibt es immer noch, es ist immer noch ein Leistungsausweis, wenn man nonstop arbeitet. Ich erinnere mich an ein Bild von meiner eigenen Bachelorette-Feier: Wir sassen alle am Laptop! Aber ich muss sagen, dass San Francisco der Schweiz in der Debatte um mentale Gesundheit schon voraus ist. Dort hat man heute verstanden, dass die Gründer:innen es nicht allein schaffen können. Wenn man im Valley in einen Founder investiert, bekommt dieser als Erstes einen Coach an die Seite gestellt, Leadership-Seminare und Austausch mit anderen. Man kann doch nicht Millionen in komplett unerfahrene 25-Jährige pumpen, ihnen keine Hilfe anbieten und sich dann wundern, wenn sie unter dem Druck wanken. Ein Coach kostet deutlich weniger als ein gescheitertes Investment.
"Ich hatte keine Ahnung, dass ich jemals an mein Limit kommen könnte"
Sie haben heute zwei kleine Kinder. Mussten Sie erst Mutter werden, um auf sich selbst zu achten?
Nein, ich glaube, ich achte eher weniger auf mich, seit ich Mutter bin. (lacht)
Sie möchten das Scheitern enttabuisieren. Aber tatsächlich ist Scheitern nur okay, wenn man daraus etwas Neues schafft, oder? Man nennt das dann «Failing Forward». Kann man nicht einfach in Ruhe scheitern?
Ja, das ist mit ein Grund, warum ich erst keine Interviews zu diesem Thema führen wollte. Weil jetzt das Narrativ ist, dass ich gescheitert bin, total viel daraus gelernt habe und mit meiner neuen Firma alles gut wird. So einfach ist es natürlich nicht – was, wenn ich wieder scheitere? Da baue ich mir direkt wieder neuen Druck auf. Aber das Leben ist komplex, es ist die Realität, dass man im Leben viele Male scheitert und wenn man ein risikofreudiges Leben führt, dann wahrscheinlich besonders oft. Aber ich gebe Ihnen recht, nicht jedes Hinfallen ist sofort eine Heldengeschichte. Manchmal ist es einfach hart. Wichtig ist: Scheitern ist kein Charakterurteil. Es sagt nichts über Wert oder Fähigkeiten eines Menschen.
Was unterscheidet die Schweiz von den USA, wenn es um technologische Umbrüche geht?
In den USA wagen es tausende Start-ups, an die ganz grossen Systeme ranzugehen – Banken, Pharma oder Transport. Sie denken riesig, manchmal fast grössenwahnsinnig. In der Schweiz hingegen fehlt uns dieser Mut oft. Wir haben brillante Leute an der ETH, die Technologien entwickeln, die wirklich fundamental sind. Aber statt daraus Weltfirmen zu bauen, verkaufen wir nach drei Jahren an amerikanische Konzerne und geben uns mit einem Exit von 10 Millionen zufrieden. Das heisst: Die grossen Transformationen passieren – nur nicht durch uns. Meine Sorge ist, dass wir dadurch den Technologiewandel verschlafen. Wir müssten mehr Gründer:innen ermutigen, Risiken einzugehen, auch wenn das bedeutet, dass sie scheitern könnten.
"Nicht jedes Hinfallen ist eine Heldengeschichte"
Die Tech-Szene galt lange als progressiv. Aber ist sie das wirklich? Warum gibt es immer noch so wenige weibliche Vorbilder?
Ehrlich gesagt tut sich da noch zu wenig. Es gibt schlicht zu wenige Frauen, die sichtbar sind. Und die paar, die es in die Sichtbarkeit schaffen, werden ständig mit Häme oder Vergleichen überzogen – von Medien wie auch aus der Branche selbst. Investor:innen orientieren sich noch immer an Stereotypen: Sie suchen den nächsten Mark Zuckerberg. Frauen passen nicht in dieses Muster. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich mit Elizabeth Holmes verglichen wurde. Nur weil ich eine Frau bin und auch unsere Firma im Gesundheitswesen war. Ständig! Es herrscht eine Atmosphäre, die eher abschreckt als ermutigt. Wenn du dich als Frau im Silicon Valley zu sehr exponierst, wirst du gnadenlos zerlegt.
Was machen Sie heute grundlegend anders?
Heute exponiere ich mich weniger, baue Strukturen so, dass sie auch ohne mich funktionieren. Mit kleinen Kindern ist das für mich derzeit richtig – aber manchmal frage ich mich, ob ich ohne diese emotionale Bindung je wieder dieselbe Wucht entwickeln kann. Und ja, ich predige, dass man nach einem Scheitern wieder Neues wagen sollte. Aber ehrlich gesagt: Ich habe zwar mit meiner neuen Firma «expeerly» etwas Neues gewagt, aber nicht im grossen Stil. Ich will nicht so tun, als wäre ich längst wieder dort, wo ich andere gerne sehen würde.
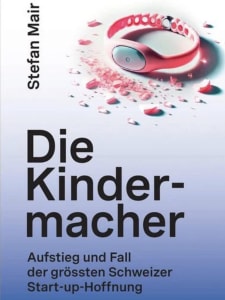
Stefan Mair: «Die Kindermacher, Aufstieg und Fall der grössten Schweizer Start-up-Hoffnung», Beobachter Edition, 208 Seiten, ca. 30 Fr.








Oh ich erfahre gerade erst jetzt davon dass es AVA nicht mehr gibt, ein tolles Produkt, ich wurde mit der Uhr in 4 Jahren 4 mal schwanger (3 Kinder + ein sehr früher Abgang, ohne AVA hätte ich die ssw gar nicht erst bemerkt). Ich habe bis per dato die Uhr überall empfohlen. Unvorstellbar dass AVA gescheitert ist. Alles gute an Lea, und Danke für meine drei Kinder!