
Bestseller-Autor Bas Kast: "Schon ab drei Gläsern Alkohol pro Woche steigt das Brustkrebsrisiko deutlich"
Vom Muskelabbau bis hin zum stark erhöhten Brustkrebsrisiko – gerade Frauen sollten die neuesten Erkenntnisse zu Alkoholkonsum kennen. Bas Kasts neues Buch "Warum ich keinen Alkohol mehr trinke" wirft einen nüchternen Blick auf die Fakten.
- Von: Sarah Lau
- Bild: Mike Meyer
annabelle: Eine Überarbeitung ist geplant, noch aber empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung als risikoarmen Alkoholkonsum zwei Standardgläser pro Tag, für Frauen gilt eines am Tag. Dabei wird als "Risiko" die Abhängigkeit bewertet, nicht aber die gesundheitlichen Schäden. Ist das in Ihrem Sinne?
Bas Kast: Nein – und ich bin sicher, dass auch die Schweiz nach der Zero-Alkohol-Strategie von Kanada, den Niederlanden und Deutschland die Empfehlungen zeitnah korrigieren wird. In der 2018 erschienenen Edition vom "Ernährungskompass" dachte ich auch noch, dass ein moderater Alkohol-Konsum Vorteile haben könnte. Mittlerweile weiss ich, dass das ein Mythos war, und sehe es als meine Verantwortung, diese neuen Erkenntnisse weiterzugeben.
Was hat sich getan?
In Kanada hat man eine umfassende Neubewertung der Daten vorgenommen. Lange sah es so aus, als ob moderate Trinker:innen gesünder wären als Abstinenzler:innen. Heute wissen wir, dass gerade die moderaten Trinker:innen oft aus einer privilegierten Gesellschaftsschicht kommen, mehr auf ihre Gesundheit achten, regelmässig zum Arzt gehen, sich bewegen, gesund essen – und deshalb länger leben. Zudem fanden sich in der Gruppe der Abstinenzler:innen oft Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen aufgehört hatten zu trinken, also vorbelastet waren. Das alles war nicht berücksichtigt worden.
Frauen wird Alkohol gern als Me-Time verkauft: die Ladies’ Night im Kino kommt mit Prosecco, das Glas Rosé in der Badewanne gehört zur Entspannung – fatal?
Ja, vor allem weil Frauen im Vergleich zu Männern gesundheitlich gefährdeter sind. Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen werden nur noch ein bis zwei Gläser Wein von 140 Milliliter oder ein bis zwei kleine Flaschen Bier pro Woche als risikoarm eingestuft. Schon ab drei bis sechs Gläsern pro Woche sieht man einen deutlich messbaren Anstieg des Brustkrebsrisikos. Drei Gläser sind schnell erreicht – hie und da ein Wein zum Essen, ein Aperitif am Wochenende.
Wie hoch ist das Risiko konkret? Gibt es Zahlen?
Ja. Studien zeigen, dass bereits ein Glas Alkohol pro Tag das Brustkrebsrisiko um etwa sieben bis zehn Prozent erhöht. Zwei Gläser pro Tag steigern das Risiko um etwa zwanzig Prozent. Das klingt vielleicht erst mal nicht nach viel, aber wenn man bedenkt, dass Brustkrebs ohnehin die häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist, wird es dramatisch. Eine WHO-Umfrage in mehreren europäischen Ländern hat zudem ergeben, dass nur eine von fünf Frauen von dem Zusammenhang zwischen moderatem Alkoholkonsum und einer Erhöhung des Brustkrebsrisikos weiss – der Aufklärungsbedarf ist enorm.
Warum genau erhöht Alkohol eigentlich das Brustkrebsrisiko?
Das ist nicht abschliessend geklärt, aber es gibt mehrere plausible Mechanismen. Alkohol wird im Körper zu Acetaldehyd abgebaut – einer nachweislich krebserregenden Substanz, die DNA-Schäden verursachen und Mutationen fördern kann. Zudem beeinflusst Alkohol den Hormonhaushalt, insbesondere den Östrogenspiegel. Es gibt Hinweise darauf, dass er den Abbau von Östrogen in der Leber verlangsamt, sodass der Spiegel im Blut steigt. Viele Brustkrebsarten sind östrogensensitiv, das bedeutet, dass hohe Östrogenspiegel das Wachstum von Krebszellen fördern können.
"Wenn Frauen Krafttraining machen, um ihre Knochengesundheit zu erhalten, torpediert jeder Gin Tonic ihre Bemühungen"
Wie sieht es mit Alkoholkonsum während der Wechseljahre aus?
Einige typische Beschwerden der Menopause – wie schlechter Schlaf, Brain Fog, Müdigkeit und nachlassende Muskelkraft – können durch Alkohol verstärkt werden. Zudem schwächt Alkohol die Knochengesundheit. Da der sinkende Östrogenspiegel in den Wechseljahren bereits zu einer verringerten Knochendichte führt, kann Alkohol diesen Effekt verstärken, indem er die Kalziumaufnahme hemmt und die Aktivität knochenaufbauender Zellen reduziert. Gleichzeitig schwächt Alkohol die Proteinsynthese und damit die Muskelbildung, die ja die Knochen zum Wachstum anregt. Wenn also Frauen Krafttraining machen, um durch starke Muskeln ihre Knochengesundheit zu erhalten, torpediert jeder Gin Tonic ihre Bemühungen. Und das ist nicht alles …
Was denn jetzt noch?
Eine der erschreckendsten Erkenntnisse ist, dass schon ein bis zwei Drinks am Tag mit einem geringeren Gehirnvolumen einhergehen. Besonders betroffen ist der Hippocampus, eine Art Zwischenspeicher des Gehirns.
Klingt auch wieder verdächtig nach einer möglichen Verstärkung einer klassischen menopausalen Begleiterscheinung, des Brain Fog.
Mehr noch, Alkohol ist geschlechtsunabhängig ein klarer Risikofaktor für Demenz – etwa durch die Schädigung des Gehirns, die verringerte Aufnahmefähigkeit von Vitamin B wie auch indirekt durch seine Wirkung auf den Schlaf.
Warum spielt der Schlaf dabei eine Rolle?
Unser Gehirn hat eine Art Kläranlage, das glymphatische System, das im Schlaf aktiv ist. Dieses System spült Giftstoffe aus dem Gehirn – darunter Beta-Amyloid, ein Protein, das bei Alzheimer eine Schlüsselrolle spielt. Wenn der Schlaf gestört ist – und Alkohol beeinflusst die Schlafarchitektur nachweislich negativ –, dann funktioniert diese "Waschanlage" nicht richtig. Langfristig steigt so das Alzheimer-Risiko.
Und was ist dran am angeblich gesunden Glas Rotwein, das uns vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen und das Leben verlängern soll?
Resveratrol im Rotwein gilt längst nicht mehr als der Anti-Aging-Wirkstoff, als der er einst angepriesen wurde. In vielen Studien sind die verwendeten Resveratrol-Dosen eh so hoch, dass man ein ganzes Fass Wein trinken müsste, um eine gesundheitsfördernde Wirkung wie die etwaige leichte Erhöhung der Knochendichte während der Menopause zu erzielen – und das steht nicht im Verhältnis zu den negativen Auswirkungen des Alkohols.
"Wir suchen immer nach Beispielen, die uns vor einer Verhaltensänderung bewahren"
Gibt es Spirituosen, die besonders problematisch sind?
Ja, in Likör, Sherry, Grappa oder Calvados steckt oft schon freies Acetaldehyd. Und wenn man sich Länder anschaut, in denen diese Getränke beliebt sind – wie Italien oder Ungarn –, sieht man dort auch auffällig hohe Krebsraten im oberen Verdauungstrakt.
Grappa ist auch in der Schweiz verbreitet und wird oft als "Verdauerli" nach einem schweren Essen serviert. Ist da was dran?
Es gibt keine klare physiologische Erklärung, warum etwas Kalorienhaltiges die Verdauung fördern sollte.
Apropos Kalorien – wie sieht es denn damit aus?
Alkohol liefert sieben Kalorien pro Gramm – das ist mehr als die so oft als Dickmacher verteufelten Kohlenhydrate mit vier Kalorien pro Gramm und fast so viel wie Fett mit neun. Das wird oft unterschätzt. Zudem steigert Alkohol den Appetit. Ein Glas Wein macht das Essen attraktiver, man isst mehr, bleibt länger sitzen und nimmt sich vielleicht noch eine weitere Portion.
Was passiert eigentlich im Körper, wenn ich den ersten Schluck eines alkoholischen Getränks nehme?
Die Verarbeitung beginnt schon im Mund, und nach wenigen Minuten ist der Alkohol im Blutkreislauf. Dann passiert etwas Interessantes: Es wird vermutet, dass der Körper seinen Abbau priorisiert, weil er Alkohol als Gift erkennt.
Das bedeutet?
Dass andere Stoffwechselprozesse, zum Beispiel die Fettverbrennung, pausieren. Solange der Körper mit dem Alkoholabbau beschäftigt ist, werden Fette und Kohlenhydrate nicht so effektiv verwertet. Das ist einer der Gründe, warum regelmässiger Alkoholkonsum oft mit Gewichtszunahme einhergeht.
Wenn man das alles hört, fragt man sich: Warum trinken wir trotzdem so gern?
Alkohol hat eine komplexe Wirkung auf das Gehirn. Einerseits dämpft er Stress, entspannt uns, macht uns lockerer und signalisiert uns durch akute Dopamin-Ausschüttung, dass es ein unsere Erwartungen übertreffender Abend ist. Dazu senkt er Hemmungen – deshalb greifen viele auch zur Zigarette, wenn sie trinken.
Der Klassiker: "Ich rauche nicht – ausser, wenn ich trinke."
Und das ist sehr gefährlich. Es gibt Studien, die zeigen, dass Rauchen und Trinken zusammen die Acetaldehyd-Konzentration im Mund um das Siebenfache erhöhen. Das heisst, wer beides kombiniert, setzt sich einem besonders hohen Risiko aus – vor allem für Krebs im Mund- und Rachenraum.
"Mein Onkel trinkt jeden Abend eine halbe Flasche Wein, er ist 86 – und ihm geht es super": Warum halten sich solche Anekdoten so hartnäckig?
Wir suchen immer nach Beispielen, die uns vor einer Verhaltensänderung bewahren. Denken wir nur an Jeanne Calment, die älteste Frau der Welt. Sie hat fast ihr ganzes Leben geraucht, liebte Portwein und ist 122 geworden. Solche Geschichten klingen faszinierend, sind aber eben nur das: Einzelfälle.
Ein Argument, das oft kommt: "Meine Leberwerte sind in Ordnung, also kann ich weitertrinken." Richtig?
Die Vorstellung, dass nur die Leber leidet, wenn man trinkt, ist weit verbreitet. Ein grosses Blutbild zeigt zwar einiges, aber viele Schäden durch Alkohol lassen sich damit gar nicht messen.
"Studien zeigen aber selbst bei Menschen mit langjährigem Alkoholkonsum, dass sich das Hirnvolumen nach ein paar Monaten wieder erholen kann"
Rund 85 Prozent der Schweizer:innen trinken Alkohol, wobei mehr als die Hälfte sich mindestens einmal wöchentlich einschenkt. Alle, die neu in der abstinenten Fraktion sind, wissen, wie hoch der Sozialdruck ist, ein angebotenes Glas Wein abzulehnen. Was würden Sie jemandem raten, der weniger trinken möchte?
Das Beste ist, es einfach mal auszuprobieren. Ein Monat ohne Alkohol kann schon viele Aha-Momente bringen. Man merkt, wie viel besser man schläft, wie die Energie steigt und man sich klarer fühlt. Und wenn man dann doch wieder trinkt, wird man wahrscheinlich sehr bewusst spüren, wie sich Alkohol tatsächlich auf den Körper auswirkt.
Was bringt es genau, mit dem Trinken aufzuhören?
Schon nach wenigen Tagen schläft man tiefer und erholsamer. Und mit besserem Schlaf kommen mehr Energie, bessere Konzentration und eine stabilere Stimmung. Nach etwa drei Wochen normalisieren sich die Werte von Osteocalzin, einem Hormon, das für die Knochengesundheit wichtig ist. Auch die Muskeln regenerieren sich besser.
Wie sieht es mit dem Gehirn aus?
Das Gehirn braucht je nach Schädigung etwas länger. Studien zeigen aber selbst bei Menschen mit langjährigem Alkoholkonsum, dass sich das Hirnvolumen nach ein paar Monaten wieder erholen kann. Die Nervenzellen, Zellstrukturen und Synapsen können sich regenerieren. Besonders das Volumen des Hippocampus, der für das Gedächtnis wichtig ist, kann sich mit einem gesunden Lebensstil inklusive Bewegung und Meditation noch stärker verbessern.
Gibt es auch langfristige Risiken, die bleiben?
Ja, und das betrifft vor allem das Krebsrisiko. Eine grosse Studie, veröffentlicht im "New England Journal of Medicine", zeigt, dass das Krebsrisiko bei Abstinenzler:innen wieder sinken kann – allerdings je nach Krebsart erst nach Jahren oder auch Jahrzehnten. Auch wenn der Effekt nicht immer sofort sichtbar ist, haben Menschen, die aufhören zu trinken, langfristig einen enormen gesundheitlichen Vorteil.
Es lohnt sich also, aufzuhören – egal wann?
Ja. Viele denken: "Der Schaden ist doch eh schon da." Aber das stimmt nicht. Der Körper kann sich erstaunlich gut regenerieren.
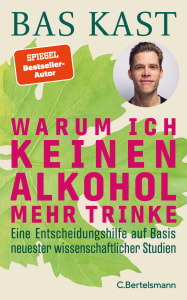
Der deutsche Wissenschaftsjournalist Bas Kast wurde mit "Der Ernährungskompass" zum Bestsellerautor. Sein neustes Buch heisst "Warum ich keinen Alkohol mehr trinke" und kostet ca. 30 Franken.







